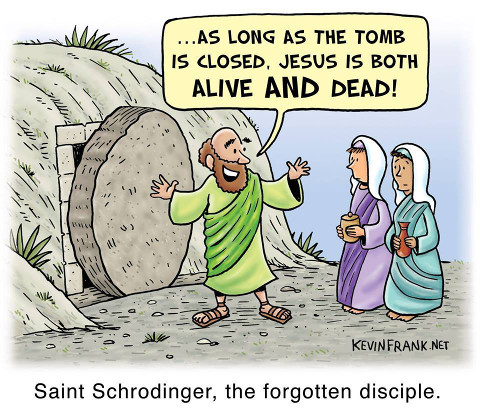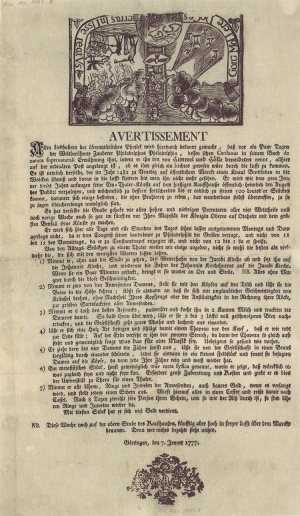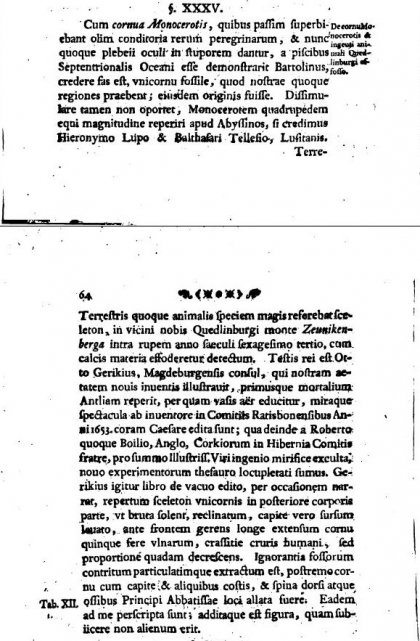Schrödingers Katze
Jitzhak Speizmann aus Peine oder irgendeinem anderen Ort fragt:
„Lieber WikipeteR, ist Schrödingers Katze tot oder lebendig?“WikipeteR antwortet: Sehr verehrter Herr Speizmann, sie ist gleichermaßen tot und lebendig, das ist doch der Clou an der ganzen Sache. Wäre ihr Zustand eindeutig und nicht unbestimmt, dann wäre es auch nicht Schrödingers Katze, sondern vielleicht die Katze der pfeiferauchenden polnischen Nachbarin und wir könnten am Geruch der Fußmatte feststellen, daß sie noch lebt. Doch hören wir den Meister selbst.
„Man kann auch ganz burleske Fälle konstruieren. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit folgender Höllenmaschine (die man gegen den direkten Zugriff der Katze sichern muß): in einem Geigerschen Zählrohr befindet sich eine winzige Menge radioaktiver Substanz, so wenig, daß im Laufe einer Stunde vielleicht eines von den Atomen zerfällt, ebenso wahrscheinlich aber auch keines; geschieht es, so spricht das Zählrohr an und betätigt über ein Relais ein Hämmerchen, das ein Kölbchen mit Blausäure zertrümmert. Hat man dieses ganze System eine Stunde lang sich selbst überlassen, so wird man sich sagen, daß die Katze noch lebt, wenn inzwischen kein Atom zerfallen ist. Der erste Atomzerfall würde sie vergiftet haben. Die Psi-Funktion des ganzen Systems würde das so zum Ausdruck bringen, daß in ihr die lebende und die tote Katze (s.v.v.) zu gleichen Teilen gemischt oder verschmiert sind. Das Typische an solchen Fällen ist, daß eine ursprünglich auf den Atombereich beschränkte Unbestimmtheit sich in grobsinnliche Unbestimmtheit umsetzt, die sich dann durch direkte Beobachtung entscheiden läßt. Das hindert uns, in so naiver Weise ein ‚verwaschenes Modell‘ als Abbild der Wirklichkeit gelten zu lassen. An sich enthielte es nichts Unklares oder Widerspruchsvolles. Es ist ein Unterschied zwischen einer verwackelten oder unscharf eingestellten Photographie und einer Aufnahme von Wolken und Nebelschwaden.“ Erwin Schrödinger, Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. § 5. Sind die Variablen wirklich verwaschen? November 1935Und da Schrödingers Katze nun keine wirkliche Versuchsanordnung ist, sondern nur ein burleskes Gedankenexperiment, das uns die Quantenphysik näher bringen kann oder auch nicht, gibt es auch noch verschiedene Interpretationen der Abläufe im geschlossenen Kasten, als handle es sich nicht um ein physikalisches Phänomen, sondern um ein Gemälde, einen literarischen Text oder das Heilige Buch einer Religion. So sind nach der Dekohärenztheorie der Detektor in der Vergiftungsapparatur und damit auch die Katze selbst eine Meßapparatur: Der Zerfall des Atomkerns führt zur Dekohärenz der Wechselwirkungen zwischen Atomkern und Detektor. Nach der Kopenhagener Deutung entscheidet sich erst bei der Messung ob die Katze tot oder lebendig ist. Vor der Messung kann über den Zustand der Katze lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage getroffen werden. Meine Lieblingsglaubensrichtung ist die Viele-Welten-Interpretation, die allen möglichen Zuständen (also hier „Katze tot“ und „Katze lebendig“) gleichermaßen physikalische Realität zuspricht. Es gibt dann tatsächlich ein Universum, in dem das Atom zerfallen ist, und eines, in dem das Atom noch nicht zerfallen ist. Im ersten Universum öffnen wir den Kasten und finden die Katze tot, im zweiten Universum ist die Katze lebendig. Unsere Erinnerungen und das, was wir als Realität wahrnehmen, entsprechen dann nur einer von unzähligen möglichen (und gleichermaßen realisierten) Geschichten des Universums. Bei Douglas Adams – jetzt weiß ich endlich, woher er das hat – wimmelt es ja auch von diesen Paralleluniversen. In einem scheint die Erde nicht von den Vogonen zerstört und sein Haus nicht abgerissen worden zu sein, in einem anderen lebt Elvis noch und spielt im Hinterzimmer einer Kneipe so entspannt vor sich wie in diesem Universum sonst nur am 4. Dezember 1956 bei der Jamsession mit Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins. Wenn diese Theorie stimmt, dann gibt es Trilliarden von Paralleluniversen und unter denen garantiert eines, in dem Adolf Hitler schon im April 1922 als Gefährder nach Österreich abgeschoben wurde, eines, in dem ihn die Bombe vom 20. Juli 1944 erwischt hat, eines, in dem er den Weltkrieg gewonnen hat und als Friedensfürst gilt, eines, in dem Möllemann lebt, eines, in dem der SV Schessinghausen in der 1. Bundesliga spielt, eines, in dem Arno Schmidt mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde, und eines in dem Long Dong Silver nur mit einem Mikropenis begabt ist. Uns selbst findet man in diesen Universen in zumindest drei Zuständen. In den meisten davon gibt es uns allein deshalb nicht, weil entweder wir oder schon unsere Vorfahren überhaupt nicht gezeugt worden sind – die Gründe mag sich jeder selbst ausmalen –, in einigen Universen leben wir noch und in einigen sind wir schon gestorben. Bei Schrödingers Katze müssen wir den Kasten öffnen, um zu bestimmen, in welchem Zustand sie sich befindet, zur Überprüfung des eigenen Zustands – „lebendig“ oder „tot“ – haben sich andere Methoden bewährt. Junge Eltern müssen nur durch irgendein Zimmer gehen und auf einen der Millionen herumliegenden Legosteine treten, andere zwicken oder ohrfeigen sich, wieder andere brauchen erst einmal einen Kaffee oder eine Zigarette oder beides. Nicht gut ist es, wenn man zur Zustandsvergewisserung einen Doppelkorn braucht. Ernest Hemingway soll vor dem ersten Drink und vor dem ersten Kaffee erst einmal Russisch Roulette gespielt haben, um den Zufall entscheiden zu lassen, in welchem dieser beiden Zustände – „lebendig“ oder „tot“ – er den Tag beenden sollte. Ob das wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls um 1960 herum so im Stern gelesen. Die Reportage hat mich damals dazu veranlaßt, mir „Der alte Mann und das Meer“ aus dem Bücherschrank meiner Eltern vorzunehmen. Kann Hemingway wegen dieses Nervenkitzels, den er brauchte, um den Tag zu überstehen, als Schrödingers Ernest durchgehen? Nein, denn ob sich ein Schuß löst oder nicht, hängt nicht wie das Zerfallen des Atoms im geschlossenen Kasten allein vom Zufall ab. Es gibt Faktoren wie etwa die gewählte Anfangsposition der Patrone im Revolver, das unter Umständen spürbare Gewicht der Patrone, den Zeitraum der Drehung bei eingeübter Drehgeschwindigkeit und die räumliche Ausrichtung der Trommel, die eine – bewußte oder unbewußte – Beeinflussung des Vorgangs durch den Spieler gestatten. „… as long as the tomb is closed, Jesus is both alive and dead“, sagt der „vergessene Jünger“ Erwin Schrödinger in einer dieser Tage auf Twitter weit verbreiteten Karikatur. Aber Kevin Frank irrt. Im Fall der Auferstehung kann man Schrödingers Katze nicht durch Jesus ersetzen. Denn auch hier regiert nicht der Zufall, sondern – und deshalb wird die Geschichte doch seit zwei Jahrtausenden erzählt – allein Gottes Wille und beweist zumindest der Christenheit quasi nicht die Quantentheorie, sondern dessen Allmacht.
„Und überhaupt: Schrödingers Katze ist an allem schuld!“ Peter Walther aka @archilocheion aka Scharfrichter aka Dr. Seltsam aka Herr Natürlich aka ZappMit diesen Worten sollte die heutige Kolumne enden. Das habe ich dem Fragesteller versprochen und das halte ich auch, obwohl ich zwischendurch nicht mehr wußte, wie ich die Kurve dahin noch kriegen sollte.
„SCHRÖDINGERS KATZE IST AN ALLEM SCHULD!“Mit diesen Worten endet nicht nur die heutige Kolumne, sondern vorerst auch das Projekt „Nicht verzagen – WikipeteR fragen“. Der Kolumnist macht Pause. Wie lang die sein wird, weiß er selbst noch nicht. Das hängt auch von den anderen Projekten ab, an denen er gerade sitzt oder eben wegen dieser Kolumne nicht sitzt. Bleibt noch, allen Leserinnen jeglichen Geschlechts ein schönes Osterfest zu wünschen und mich für die vielen wunderbar anregenden Fragen und das Leseinteresse zu bedanken. Danke & tschüß!